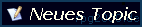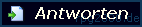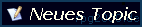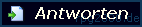Enzensberger hat geschrieben:
Ich habe nie recht verstanden, wozu Nationen da sind. Jene Leute, die am liebsten von ihnen sprechen, haben mir’s am allerwenigsten erklären können, ja, sie haben es nicht einmal versucht. Ich meine die enragierten Nationalisten und ihre Widersacher, die enragierten Anti-Nationalisten.
Seit ungefähr dreißig Jahren höre ich die einen wie die anderen sagen, daß ich ein Deutscher bin. Ich verstehe ihre Emphase nicht recht, denn was sie mir versichern, das bezweifle ich gar nicht, ich will es gerne glauben, es ist mir seit geraumer Zeit durchaus geläufig. Dennoch werden die Leute es nicht müde, jene bescheidene Tatsache immer wieder vorzubringen. Ich sehe es ihren Gesichtern an, daß sie das Gefühl haben, als hätten sie damit etwas bewiesen, als hätten sie mich aufgeklärt über meine eigene Natur und als wäre es nun an mir, mich entsprechend, nämlich als Deutscher, zu verhalten.
Aber wie? Soll ich stolz sein? Soll ich mich genieren? Soll ich die Verantwortung übernehmen, und wenn ja, wofür? Soll ich mich verteidigen, und wenn ja, wogegen? Ich weiß es nicht, aber wenn ich das Gesicht meines Gegenübers aufmerksam betrachte, kann ich erraten, welche Rolle er mir zugedacht hat. Ich kann diese Rolle ausschlagen oder akzeptieren. Aber selbst indem ich sie ausschlage, werde ich sie nicht los; denn in der Miene meines Gegenübers zeichnet sich bereits die Reaktion auf meine Reaktion ab: Empörung oder Genugtuung, Billigung oder Wut, nämlich darüber, daß ich mich, als Deutscher, so oder anders verhalte.
Meine Nationalität ist also keine Qualität, sondern eine Erwartung, die andere in mich setzen. Natürlich nur eine unter vielen derartigen „Rollenerwartungen“. Auch hinsichtlich meines sozialen Status, meines Familienstandes, meines Alters treten mir in jeder Gesellschaft gewisse idées fixes entgegen, die mich zu dem formieren oder deformieren sollen, was ich in den Augen der Gesellschaft bin: also etwa ein Dorfbewohner, ein Dreißigjähriger, ein Hausbesitzer und so weiter. Merkwürdigerweise sind alle diese Bestimmungen um so leichter abzuschütteln, je handgreiflicher sie sind. Die Nationalität, als abstrakteste und illusionärste unter ihnen, ist zugleich die hartnäckigste.
Wenn ich den Geschichtsbüchern trauen darf, so hat es, vielleicht vor dem Ersten Weltkrieg, eine Zeit gegeben, in der Nationalität mehr war als eine psychologische Größe.
Ich erkläre mir das folgendermaßen. Auf dem Weg von der steinzeitlichen Urhorde zur planetarischen Industriegesellschaft scheint die Entfaltung der Produktivkräfte irgendwann im neunzehnten Jahrhundert einen Punkt erreicht zu haben, wo die souveräne Nation ihnen ein optimales Organisationsprinzip bot. (Aus dieser fernen Zeit stammen vermutlich Beschwörungsformeln wie „Buy British“, „Deutschland, Deutschland über alles“, „La Grande Nation“ oder „Deutsche Wertarbeit“.)
Seitdem haben sich die produktiven (und destruktiven) Kräfte, über welche die Menschheit verfügt, derart weiterentwickelt, daß die Nation als Form ihrer Organisation nicht nur obsolet, sondern zu einem lebensgefährlichen Hindernis geworden ist. Souveränität ist längst zur völkerrechtlichen Fiktion geschrumpft. Nur am Biertisch wird sie noch buchstäblich und ernst genommen. Nicht einmal die Zollbeamten scheinen mehr daran zu glauben. Wie die monegassischen Garden wirken sie als Staffage. Ihr verlegenes Lächeln bittet um Entschuldigung, wenn sie uns ihr Kreidekreuz auf den Koffer malen. Wenigstens im westlichen Europa wird der Begriff des Auslandes immer mehr zur Reminiszenz. Für die Konzernverwaltungen, Fluggesellschaften und Generalstäbe existiert er nicht mehr.
Wer aus Deutschland kommt, für den ist dieses Erlöschen der Nationalität als einer gesellschaftsprägenden objektiven Kraft verhältnismäßig leicht sichtbar, leichter jedenfalls als für die Bewohner älterer Nationalstaaten. Wir haben es sehr spät zu einer nationalstaatlichen Identität gebracht, und wir haben uns ihrer nie sehr sicher gefühlt. Daher mag der hysterische Überschwang rühren, mit dem in unserem Land seit 1870 der sogenannte „nationale Gedanke“ – der streng genommen, nie ein Gedanke war – affichiert worden ist. Im Jahre 1945 ist uns diese Identität abhandengekommen, und zwar so gründlich, daß man sich fragen muß, ob von einer deutschen Nation überhaupt noch die Rede sein kann. Für einen Bürger von Frankfurt am Main liegt New York vor der Tür, dagegen ist die Reise nach Frankfurt an der Oder psychologisch, politisch und geographisch zur Expedition geworden. Der Fall beweist, daß sich Nationen rein administrativ und von außen, von einem Jahr aufs andere, zunichte machen lassen; er beweist damit die Hinfälligkeit des Prinzips der Nationalität.
Natürlich macht uns dieser Vorgang nicht zu Kosmopoliten. Obwohl der Idee der Nation objektiv nichts Handfestes mehr entspricht, lebt sie subjektiv, als Illusion, äußerst zäh weiter. Illusionen von solchen Ausmaßen sind aber ernst zu nehmen. Sie sind ihrerseits Realitäten, und zwar psychologische Realitäten von explosiver Kraft. Ich habe mich oft gefragt, was uns so fest an diese Zwangsvorstellungen fesselt. Vermutlich ist es uns zu mühsam, eigene Ressentiments und Komplexe, Idiosynkrasien und Neurosen zu entwickeln. Das Phantom der Nation stellt jedermann ein präfabriziertes seelisches Möblement zur Verfügung, in dem er sich preiswert einrichten kann. Noch dazu handelt es sich um ein Sortiment von der Stange, das die eigene Auswahl überflüssig macht und den enormen Vorzug hat, daß man es mit vielen anderen teilt. Das schafft eine gewisse behagliche Solidarität, wie man sie etwa unter Leuten beobachten kann, die dasselbe Automodell fahren.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es das schnellste oder langsamste, das beste oder das schlechteste Fabrikat ist. Neben den althergebrachten Wettlauf um Macht und Ansehen ist in unseren Tagen ein makabrer Wettbewerb getreten, den die Schatten der einstigen Nationen um die Frage austragen, wer am tiefsten gesunken sei und die größten Sorgen habe. Dieses Spiel, bei dem die alten Regeln sich in ihr Gegenteil verkehren, ist besonders unter Intellektuellen beliebt. Amerikanische Liberale führen ihr Rassenproblem ins Feld, italienische Sozialisten den Klerus, englische Kritiker ihr Establishment, russische Literaten den Stalinismus.
Bei diesem Spiel, das einen masochistischen Zug hat, gewinnen natürlich unweigerlich die Deutschen. Ihre beiden Trumpfkarten sind: die „unbewältigte Vergangenheit“ und „die deutsche Frage“. Mit diesen beiden Schlagworten sind der Faschismus und die deutsche Teilung gemeint, und um beide Sachverhalte haben sich komplizierte, genau festgelegte nationale Rituale herausgebildet.
Ich kann dieser Rituale nicht recht froh werden. Ich werde den Verdacht nicht los, daß es sich dabei um bloße Umkehrungen handelt. Allzu ähnlich sehen sich Selbstverachtung und Selbstlob, Selbstbemitleidung und Überheblichkeit. Uniberprüft bleibt dabei die Voraussetzung, die mir eitel scheint: daß es sich, wie der bezeichnende Ausdruck dafür heißt, um ein „nationales Schicksal“ handle.
Vielleicht ist es dieses illusionäre Moment, das unsere Beschäftigung mit dem Nazismus moralisch und politisch so unproduktiv macht. Die Nabelschau, die sich auf den sogenannten Volkscharakter richtet, stimmt mich nachgerade ungeduldig. Sie verklärt die Eigenschaft „deutsch“ von neuem zur metaphysischen Größe – nur daß das diesmal mit umgekehrtem Vorzeichen geschieht. Wie einst das Gute, so wird jetzt das schlechthin Böse biologisch oder rassisch lokalisiert. Auch eine gewisse Deutsch-Feindlichkeit in anderen Ländern möchte die Verbrechen der zwölf Hitler-Jahre lieber manichäisch deuten als historisch analysieren. Dort wie hier gibt man einer scheinbar ewigen, unveränderlichen bösen Substanz die Schuld, die, mit einem Wort, „typisch deutsch“ sei.
Diese Art, Vergangenheit zu „bewältigen“, ist nicht nur steril, sondern geradezu verdächtig. Mehr und mehr nimmt sie die zeremoniellen Formen einer Teufels-Austreibung an. Die offiziell zur Schau gestellte Zerknirschung ist eine abergläubische Prozedur. Ihr sonderbares Motto heißt: Qui s’accuse, s’excuse.
Ein solches Verfahren kann nie und nimmer leisten, was man sich von ihm verspricht. Niemand wird je vergessen oder verzeihen, was in Auschwitz geschehen ist. Ich kann den staatlich verordneten Massenmord im industriellen Ausmaß nicht für ein nationales Problem der Deutschen halten. Deutsche haben ihn verübt. Dieser Umstand scheint manche Leute mehr zu bekümmern und mehr zu beschäftigen als die Entdeckung, daß der Mensch zu allem fähig ist. Diese Entdeckung verharmlost, wer Auschwitz zur deutschen Spezialität, zum Produkt einer hypothetischen deutschen Volksseele machen will.
In Wirklichkeit verdient diese Volksseele keinerlei Interesse. Ich vermute, daß sie, mit Ausnahme von manchen Deutschen und Deutschenhassern, der ganzen Welt zum Halse heraushängt. Ebenso langweilig sind die monotonen Selbstanklagen, die man seit 1945 aus unserem Linde hört. Als ginge es im Ernst darum, unser kollektives Seelenheil zu retten; als wäre nicht der Begriff eines kollektiven Seelenheils selber eine unhistorische Mystifikation!
Wie unhistorisch dernationale Exorzismus bleibt, das zeigt sich an seiner Folgenlosigkeit. Wem ist damit gedient, daß sich „das deutsche Volk“, wie es in Regierungserklärungen heißt, an die Brust schlägt, wenn soviel innere Ein- und Umkehr nicht einmal jene Regierung dazu vermag, die Nazis aus ihren öffentlichen Ämtern in den Parteien, den Administrationen, der Armee, den Geheimdiensten und der Polizei zu entfernen? Was taugt eine nationale Erschütterung, die uns nicht einmal zu der Einsicht verhilft, daß zwischen dem Faschismus und der deutschen Teilung ein stringenter historischer Zusammenhang besteht? Wieviel Glauben kann man der öffentlich plakatierten Reue über die Judenhetze schenken, solange in der Bundesrepublik die lächerlichste Kommunistenhetze fortdauert?
Unsere nationale „Selbstbesinnung“ treibt viele sonderbare Blüten, aber die erstaunlichste von ihnen ist doch wohl das Verhältnis, das wir zur Sowjetunion gefunden haben. Natürlich ist die Sowjetunion der Erzfeind, das versteht sich ja beinahe von selbst. Aber nicht nur das: sondern es ist in Westdeutschland auch das Gefühl weit verbreitet, als wäre uns von Seiten der Sowjets das bitterste Unrecht widerfahren. Den Sowjets dürfen wir nicht trauen, sie sind tückisch und brutal, Angst vor ihnen ist Bürgerpflicht. Andererseits sind sie uns natürlich weit unterlegen, vor allem kulturell.
Vor mir habe ich eine kleine Landkarte. Sie trägt die Überschrift: Bevölkerungsverluste im Zweiten Weltkrieg. Auf dieser Karte sind Kreuze zu sehen: ein Kreuz steht für eine Million Getötete. Ich sehe fünf Kreuze in Deutschland, fünf Kreuze in Polen und eines in Jugoslawien stehen. Zwanzig solcher Kreuze finde ich neben dem Wort: Sowjetunion. In einem kleinen Museum in Leningrad sah ich ein daumengroßes Stück verdorrten Brotes. Das war in den Wintermonaten zur Zeit der deutschen Belagerung die Tagesration für die Einwohner der Stadt. Sie war kleiner als eine Häftlingsration in Buchenwald.
Ich habe nicht den Eindruck, daß in der Bundesrepublik irgend jemand versucht, diese Vergangenheit zu „bewältigen“. Dazu wäre das übliche Ritual auch kaum geeignet. Denn diese Vergangenheit hat direkte historische und politische Folgen, und statt unverbindlicher Schuldgefühle und seelischer Andachtsübungen legt sie Handlungen und Folgerungen für die Zukunft nahe.
Ich habe das Beispiel der Sowjetunion erwähnt, weil es zeigt, wie ungebrochen der nationale Narzißmus fortbesteht und wie wenig damit gewonnen ist, daß er sich gelegentlich mit umgekehrten Vorzeichen schmückt. Mit seinen Mitteln ist heute nichts mehr auszurichten und keine ernsthafte Frage mehr zu lösen. Krieg und Frieden, die Verschiedenheit der ökonomischen und politischen Weltsysteme, die konstante Möglichkeit des Völkermordes, zu dem täglich neue Vorbereitungen getroffen werden – das alles sind keine nationalen Probleme. Das Schlimmste an der deutschen Teilung ist nicht, daß die Deutschen unter ihr leiden, sondern daß sie zu einem Weltkrieg führen kann; die atomare Rüstung der Bundesrepublik bedroht den Frieden, nicht weil der Nationalcharakter der Deutschen teuflisch wäre, sondern weil sie die Sowjetunion provozieren muß; der Faschismus ist nicht entsetzlich, weil ihn die Deutschen praktiziert haben, sondern weil er überall möglich ist.
Ein Deutscher zu sein, das scheint mir kein schwierigeres oder leichteres Los als irgendein anderes. Es ist keine Kondition à part, sondern eine Herkunft unter vielen. Ich sehe keinen Anlaß, sie zu beklagen oder zu verleugnen, und keinen, etwas Hervorragendes in ihr zu sehen. Es liegt im Begriff jeder Herkunft, daß man sich nie ganz von ihr trennt; aber ebenso liegt es in ihrem Begriff, daß man sich jeden Tag von ihr entfernt. Meine Mitmenschen, die den Umstand, daß ich ein Deutscher bin, wichtiger nehmen, als ich es tue, will ich nicht unnütz vor den Kopf stoßen. Daß ich ein Deutscher bin, diesen Umstand werde ich akzeptieren, wo es möglich, und ignorieren, wo es nötig ist.
http://www.zeit.de/1964/23/bin-ich-ein- ... ettansicht